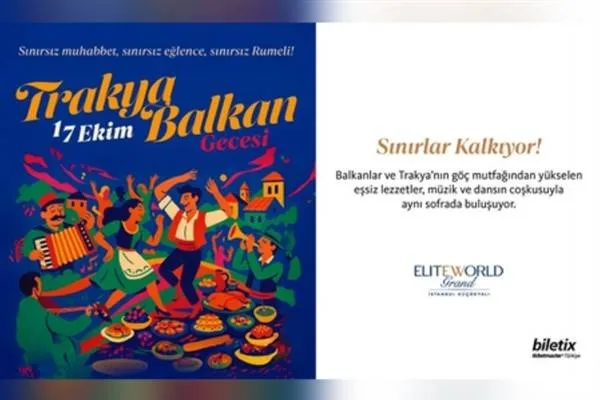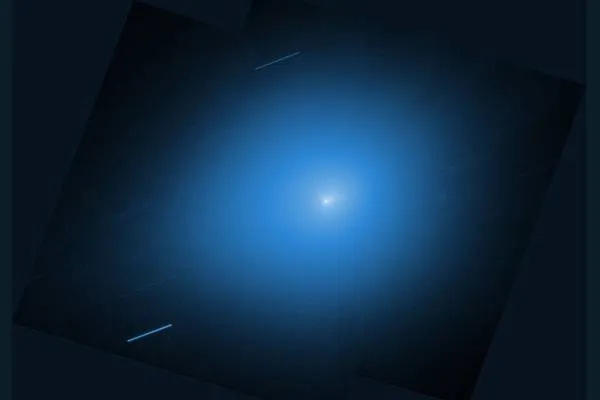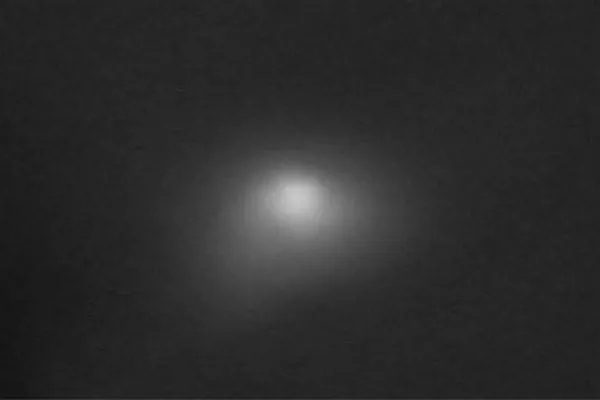Studie: Auch die reichsten Länder, einschließlich Erdölproduzenten, erhalten Klimafinanzierung
Istanbul, 15. November (Hibya) – Zu den größten Volkswirtschaften der Welt, die hohe Summen an Klimafinanzierung erhalten, gehören neben China auch wohlhabende Erdölstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).
Das in Großbritannien ansässige Fachportal Carbon Brief, das sich auf die Wissenschaft und Politik des Klimawandels spezialisiert hat, und die Zeitung The Guardian haben bisher nicht veröffentlichte Einreichungen an die Vereinten Nationen (UN) sowie Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ausgewertet, um aufzuzeigen, wie Milliarden an öffentlichen Geldern, die für den Kampf gegen die globale Erwärmung bestimmt sind, tatsächlich verwendet werden.
Die Studie, die während der laufenden UN-Klimakonferenz 2025 (COP30) in Brasilien veröffentlicht wurde, zeigt, dass es im Großen und Ganzen ein funktionierendes System gibt, das Kapital von reichen Verursachern von Emissionen in verletzliche Länder lenkt und diesen hilft, ihre Volkswirtschaften zu dekarbonisieren und sich an eine wärmere Welt anzupassen.
Zugleich macht die Untersuchung deutlich, dass die Verteilung eines großen Teils der Mittel keiner zentralen Kontrolle unterliegt und vollständig im Ermessen der einzelnen Staaten liegt. Dadurch kann politischer Einfluss eine erhebliche Rolle spielen und die Gelder fließen nicht immer dorthin, wo der Bedarf am größten ist.
Auch wenn die offiziellen Daten nicht umfassend genug sind, um alle Empfänger der Klimafinanzierung lückenlos zu erfassen, zeigt die Analyse des Guardian, dass rund ein Fünftel der Mittel in den Jahren 2021 und 2022 an 44 der ärmsten Staaten der Welt – die sogenannten „am wenigsten entwickelten Länder“ – gegangen ist. Ein Großteil dieser Mittel wurde jedoch als Kredite und nicht in Form von Zuschüssen vergeben.
Einige dieser am wenigsten entwickelten Länder erhielten mehr als zwei Drittel ihrer Klimafinanzierung in Form von Krediten, deren Rückzahlungsbedingungen ihre Regierungen noch tiefer in die Schuldenfalle treiben könnten. In Bangladesch und Angola lag der Kreditanteil bei 95 Prozent oder sogar noch höher.
Die meisten Industrieländer der Welt unterstützen Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern sowohl bilateral als auch über multilaterale Institutionen wie Entwicklungsbanken. Auf dem UN-Gipfel 2009 in Kopenhagen erkannten wohlhabende Staaten ihre größere Verantwortung für die Klimaschäden und ihre höhere Fähigkeit zur Finanzierung von Lösungen an und sagten zu, bis 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar (76 Milliarden Pfund) zu mobilisieren.
Die Auswertung der jüngsten Meldungen, die mehr als 20.000 globale Projekte in den Jahren 2021 und 2022 umfassen – also in den Jahren, in denen das Kopenhagen-Ziel schließlich, wenn auch verspätet, erreicht wurde –, zeigt jedoch, dass erhebliche Summen an Erdölstaaten und an China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, geflossen sind.
Die VAE, ein bedeutender Exporteur fossiler Brennstoffe mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf ähnlichem Niveau wie Frankreich und Kanada, erhielten von Japan Kredite in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar, die als Klimafinanzierung verbucht wurden. Zu den Projekten gehören 625 Millionen US-Dollar für ein Offshore-Stromübertragungsprojekt vor Abu Dhabi und 452 Millionen US-Dollar für eine Müllverbrennungsanlage in Dubai.
Saudi-Arabien, das aufgrund seiner riesigen Ölfelder und seines Mehrheitsanteils an Aramco zu den zehn größten CO₂-Emittenten der Welt zählt, erhielt rund 328 Millionen US-Dollar an japanischen Krediten – 250 Millionen US-Dollar für ein Elektrizitätsunternehmen und 78 Millionen US-Dollar für ein Solarkraftwerk.
Joe Thwaites, Experte für Klimafinanzierung beim Natural Resources Defense Council, erklärte, dass die gesamten Ströme der Klimafinanzierung zwar gestiegen seien, aber die ärmsten und verletzlichsten Gemeinschaften weiterhin nicht in „ausreichendem“ Maße erreichten. Stark verschuldete Länder bräuchten mehr Zuschüsse und vergünstigte Kredite.
Er fügte hinzu: „Das ist keine Wohltätigkeit. Es ist eine strategische Investition, die die grundlegenden Ursachen vieler Krisen angeht, die wir täglich erleben: Lebenshaltungskosten, Unterbrechungen der Lieferketten, Naturkatastrophen, erzwungene Migration und Konflikte.“
In dem untersuchten Zweijahreszeitraum wurden rund 33 Milliarden US-Dollar für am wenigsten entwickelte Länder wie Haiti, Mali, Niger, Sierra Leone, Südsudan und Jemen zugesagt. Ein deutlich größerer Betrag – etwa 98 Milliarden US-Dollar – floss an Entwicklungsländer. Diese breitere Gruppe umfasst Länder mit niedrigem mittlerem Einkommen wie Indien und Länder mit höherem mittlerem Einkommen wie China. Rund 32 Milliarden US-Dollar konnten keiner Kategorie eindeutig zugeordnet werden. Indien war mit insgesamt etwa 14 Milliarden US-Dollar in der Berichtsperiode der größte Einzelempfänger, während China rund 3 Milliarden US-Dollar – überwiegend von multilateralen Banken – erhielt.
Die Analyse zeigt, dass der geringe Anteil, der an die am wenigsten entwickelten Länder geht, teilweise ihre kleineren Bevölkerungen widerspiegelt. Zugleich wird die Zusammensetzung der Gruppe der „Entwicklungsländer“ zu einer wachsenden Spannungsquelle in den internationalen Klimaverhandlungen.
So hat sich etwa die chinesische Wirtschaft seit der Einstufung des Landes als „Entwicklungsland“ durch die UN in den 1990er-Jahren rasant entwickelt, und die Pro-Kopf-Emissionen liegen inzwischen über dem europäischen Niveau. Obwohl China als wichtiger Finanzier von Klimaprojekten im Ausland gilt, wehrt es sich gegen Versuche, seine Beiträge formal zu erfassen. Die Entwicklungskategorien der UN sind seit ihrer Einführung im Jahr 1992 unverändert geblieben.
Sarah Colenbrander, Klimadirektorin beim Overseas Development Institute, sagte: „Diese Situation ermöglicht es Ländern wie Israel, Korea, Katar, Singapur und den VAE, die in den letzten 30 Jahren zu wohlhabenden Staaten mit sehr großem CO₂-Fußabdruck geworden sind, sich ihren internationalen Verpflichtungen zu entziehen. Es ist absurd, dass solche Länder weiterhin in derselben Kategorie geführt werden wie Togo, Tonga oder Tansania.“
Einige der ärmsten Länder der Welt erhalten mehr als zwei Drittel ihrer Klimafinanzierung in Form von Krediten – trotz Warnungen, dass viele von ihnen nicht in der Lage sein werden, die Konditionen und Zinszahlungen zu erfüllen.
Ritu Bharadwaj, Direktorin für Klimafinanzierung am International Institute for Environment and Development, erklärte: „Die verborgene Geschichte der Klimafinanzierung liegt nicht im Umfang der Zusagen, sondern in ihrer Ausgestaltung. Klimafinanzierung erhöht die finanzielle Last für arme Länder. Selbst wenn es sich um vergünstigte Kredite handelt, enthalten diese häufig Bedingungen, die eher dem Kreditgeber als dem Empfänger zugutekommen.“
Laut Daten der Weltbank zahlten die am wenigsten entwickelten Länder im gleichen Zeitraum insgesamt rund 91,3 Milliarden US-Dollar an Auslandsschulden zurück – das Dreifache ihrer Budgets für Klimafinanzierung. In den letzten zehn Jahren haben sich die Rückzahlungen der Auslandsschulden der ärmsten Länder verdreifacht – von 14,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 auf 46,5 Milliarden im Jahr 2022.
Shakira Mustapha, Finanzexpertin an einem Zentrum für Katastrophenschutz, sagte: „Nach herkömmlicher Auffassung ist eine höhere Verschuldung nicht unbedingt schlecht, wenn sie dazu genutzt wird, wachstumsfördernde Ausgaben zu finanzieren. Meine Sorge ist, ob Länder neue Schulden aufnehmen, nur um alte zu tilgen – und ob wir das Problem damit nicht einfach in die Zukunft verschieben.“
Deutsche Nachrichtenagentur Wp Aktuell